FRANKFURT/MAIN (inn) – Die unterschiedlichen Perspektiven bei der Erinnerung an das Jahr 1948 haben zwei israelische Historiker am Donnerstag auf einer Konferenz in Frankfurt am Main thematisiert: Motti Golani von der Universität Tel Aviv stellte das israelische Narrativ vor, Adel Manna vom Jerusalemer Van-Leer-Institut die palästinensische Sicht. Der Jude und der Araber haben gemeinsam ein Buch geschrieben, in dem sie die beiden so gegensätzlichen Narrative darlegen.
Es gebe nicht eine einzige Erinnerung für alle Juden, sagte Golani. Doch in einem geordneten Staat werde eine dominante Erinnerung gelehrt. Beim israelischen Narrativ sei klar: „Die Araber haben angefangen.“ Für die Juden habe es keine Alternative zum Krieg gegeben. Sie seien aber auch am Tag nach der Staatsgründung von sieben arabischen Armeen mit modernen Waffen angegriffen worden. Davor hätten die Briten alles getan, damit die Araber am Ende siegreich sein würden. Israelische Juden verbänden mit dem Unabhängigkeitskrieg die positive Erfahrung ihres Sieges. Dabei stellte Golani eine Parallele her zwischen der Vertreibung der Familie seiner Mutter durch die Nationalsozialisten und der Vertreibung von Arabern infolge des Krieges.
Balfours „koloniales Angebot“
Manna wiederum begann seine Ausführungen mit der Bemerkung, der 1948er-Krieg sei „das traumatischste Ereignis in der palästinensischen Geschichte“. Daran bestehe kein Zweifel. Auf der palästinensischen Seite gebe es allerdings kein festgelegtes Narrativ, nur eine Art „Makro-Narrativ“. Israel habe alle möglichen Jugendorganisationen, die von der Wahrheit der Darstellung überzeugen wollten. Ob auch palästinensische Jugendliche in Bildungseinrichtungen eine bestimmte Perspektive vermittelt bekommen, verschwieg der israelische Araber.
Traumatisch sei die Erinnerung an 1948, „vor allem da, wo es Vertreibung und Massaker gab“, ergänzte Manna. Dem Makro-Narrativ zufolge machte der britische Außenminister Arthur James Balfour 1917 Leuten ein „koloniales Angebot“, die zum größten Teil außerhalb des Landes wohnten – während die Araber 90 Prozent der Bevölkerung ausmachten, Nach der Staatsgründung habe es dann geheißen: „Ihr seid eine nicht-jüdische Minderheit.“ Die Araber hätten sich nicht organisieren dürfen in der Mandatszeit, die Hagana, die Untergrund-Armee, schon. Israel sei schuld am Krieg. Das palästinensische Narrativ sei viel näher an der historischen Wahrheit als das jüdische.
Zur Untermalung ließ Manna seine eigene Familiengeschichte mit einfließen: 1958 verlangte die israelische Militärregierung von allen arabischen Schulen, eine Woche lang „zehn Jahre Staat Israel“ zu feiern. Darauf habe sein Vater ihm, der damals in der vierten Klasse war, eröffnet, dass sie seinerzeit aus einem Dorf bei Akko vertrieben worden seien. Dort hätten Soldaten unschuldige Männer wahllos erschossen, obwohl die Bewohner schon kapituliert hatten. Über Nablus, Jordanien und Syrien seien sie in den Libanon gelangt und erst im Sommer 1951 nach Israel zurückgekehrt. Er frage sich manchmal, was aus ihm geworden wäre, wenn er im Flüchtlingslager im Libanon geblieben wäre.
Unabhängigkeitskrieg nicht aus Kontext lösen
Golani betonte: „Es gibt keine objektiven Historiker“ – und fügte scherzhaft hinzu: „außer mir“. Ein Historiker frage nie: „Wer hat angefangen?“ Es sei falsch, 1948/49 als losgelöstes Ereignis zu behandeln. Der Konflikt zwischen den beiden Gesellschaften habe viel früher begonnen. Und der Krieg von 1948 sei bis heute nicht beendet – für beide Seiten. Als „zionistischer israelischer Jude“ wolle er noch anmerken: Vom Starken sei Verantwortung zu erwarten. Deshalb müsse Israel den Palästinensern helfen, aus dem Trauma herauszukommen.
Manna stimmte zu: Die „Nakba“, also die „Katastrophe“ der israelischen Staatsgründung, sei kein beendetes historisches Ereignis, sondern ein Prozess, der noch andauere. Dies zeige sich etwa in der Blockade des Gazastreifens. Nicht eine Seite habe Schuld am Konflikt. Aber der Besatzer trage mehr Verantwortung. Eine Demokratie müsse vor allem für ihre Minderheiten sorgen. Dabei bezeichnet er sich als „israelischen Bürger, dem es nicht egal ist, wie es Israel geht“ – und verwies auf sein Engagemant in Friedensprojekten.
Was sind Ostjuden?
Einen anderen Aspekt brachte der Akademiker Avi Picard ein, der an der Bar-Ilan-Universität in Ramat Gan zur israelischen Gesellschaft forscht: Er beschrieb die Geschichte der Einwanderung der orientalischen Juden nach Israel. Ein wichtiger Aspekt dabei sei die Überheblichkeit. In einer bestimmten Zeit hätten Deutsche angefangen, Juden als „Semiten“ zu beschimpfen. Doch deutsche Juden hätten sich selbst als „Deutsche mosaischen Bekenntnisses“ bezeichnet und verächtlich von „Ostjuden“ gesprochen, die schmutzig und ungebildet seien. Diese wiederum hätten betont, sie seien „osteuropäische Juden“, aber „Juden aus islamischen Ländern“ seien schmutzig und ungebildet. Daraufhin hätten Juden in Nordafrika von sich als „Juden aus Südfrankreich“ gesprochen und auf „Bergjuden“ außerhalb der Städte herabgeschaut.
 Foto: Israelnetz/Elisabeth Hausen
Foto: Israelnetz/Elisabeth HausenPicard erinnerte an einen algerischen Juden, der 1897 am 1. Zionistischen Kongress in Basel teilnahm: Er sei viel europäischer gewesen als polnische Juden. Die Verachtung der aus Europa stammenden Israelis gegenüber den Orientalen, die als „Misrachim“ bekannt sind, habe in den ersten Jahrzehnten die Beziehungen in Israel geprägt. Von 1948 bis 1951 seien 680.000 Juden in den neugegründeten Staat eingewandert – die Hälfte sei aus islamischen Ländern gekommen. Hatten führende Israelis bis dahin Angst vor einer arabischen Mehrheit im jüdischen Staat gehabt, sei daraufhin die „zweite demographische Befürchtung“ ausgesprochen worden: „Was, wenn die Zahl der Misrachim die westlichen Juden übersteigt?“ Heute allerdings hätten die Orientalen einen guten Stand in Israel. Das zeige unter anderem Mimuna, ein marokkanisches Fest, das mittlerweile Politiker verschiedenster Couleur mitfeierten. Auch der Aufstieg der sephardisch-orthodoxen Schass-Partei sei ein Zeichen für diese Entwicklung.
Mit Israel als „Heimstätte für alle Juden“ befasste sich die Tel Aviver Historikerin Orit Rozin. In ihrem Vortrag ging sie auf das Projekt ein, einen „neuen hebräischen Menschen“ zu schaffen. Demnach sollten Einwanderer und im Lande Geborene gemeinsam eine neue jüdische Identität bilden. Diese habe sich im Hebräischen als Alltagssprache ebenso ausgedrückt wie in einem „neuen kulinarischen Repertoire“. Zentral sei aber auch die Umdeutung religiöser jüdischer Feiertage gewesen. So hätten Juden im Mandatsgebiet Palästina angefangen, öffentliche Sederfeiern zu veranstalten. Das Chanukkafest sei säkular-national umgedeutet worden. Das Neujahrsfest der Bäume, TU BiSchwat, sei zu einem zentralen Fest geworden, weil es die Liebe zum Land ausdrücke, die Zionisten bei dieser Gelegenheit Kindern vermittelt hätten.
Wie deutsche Juden die israelische Justiz bereicherten
Die Historikerin Fania Oz-Salzberger von der Universität Haifa schilderte in ihrem Vortrag am Freitag den Einfluss der deutschen Juden, der „Jeckes“, zur israelischen Demokratie. Dabei handele es sich um eine komplizierte Erfolgsgeschichte, vielleicht ähnlich wie bei der Demokratie der Bundesrepublik. Doch dank der Gewaltenteilung sei die Demokratie in Israel nicht gefährdet. Erstaunlich findet sie, dass diese Staatsform in Israel entstehen konnte, obwohl ein Großteil der vor 70 Jahren dort lebenden Juden aus nicht-demokratischen Ländern kam – auch David Ben-Gurion.
Den Schlüssel für die starke Gewaltenteilung sieht Oz-Salzberger in den Einrichtungen der Justiz: dem Obersten Gerichtshof, der Generalstaatsanwaltschaft, dem staatlichen Rechnungsprüfer. Sie bildeten ein gutes Gegengewicht zu Legislative und Exekutive. In Frankfurt führte die Wissenschaftlerin aus, dass diese Organe in der Zeit vor der Staatsgründung maßgeblich von Jeckes geprägt worden sei. Schon unter der Mandatsregierung hätten die Juden in Palästina erste Justizorgane einrichten können. Die meisten der eingewanderten Jeckes seien gebildet, professionell und kultiviert gewesen. Sie hätten das Rechtswesen aus der Weimarer Republik mitgebracht.
 Foto: Israelnetz/Elisabeth Hausen
Foto: Israelnetz/Elisabeth HausenStaatsgründer Ben-Gurion habe bewusst deutschstämmige Juristen berufen, etwa den ersten Justizminister Pinchas Rosen, der unter dem Namen Felix Rosenblüth in Berlin geboren war. Aus Sicht der Historikerin finden sich die „Fingerabdrücke der Jeckes“ im liberal-demokratischen israelischen Rechtssystem. Angesichts dieses Beitrags „war die Weimarer Republik nicht vergeblich“, folgerte sie.
Die Frage, ob Israel eher jüdisch oder eher demokratisch sein soll, stellt sich indes für die Referentin nicht: Aus ihrer Sicht hat sich das angelsächsische Recht aus der Hebräischen Bibel gespeist. Dort kämen die Ideen einer pluralistisch-liberalen Demokratie und einer republikanischen Staatsform bereits vor. Deshalb habe die Demokratie eine „jüdische DNA“.
Diplomat: Israelboykott führt in die Steinzeit
Liran Sahar vom Generalkonsulat des Staates Israel in München wies in seinen Ausführungen darauf hin, dass Israel heute nicht mehr bedürftig sei. Umstände wie der Mangel an Ressourcen und die bedrohte Sicherheit hätten die Israelis dazu gezwungen, kreativ zu werden. So seien das Raketenabwehrsystem „Iron Dome“ – mit amerikanischer Hilfe – oder die Tröpfchenbewässerung als Antwort auf die widrigen Bedingungen in der Wüste entwickelt worden. Heute profitierten von diesen Errungenschaften Menschen in anderen Ländern. Im Hinblick auf die zahlreichen israelischen Entwicklungen unter anderem im Hightech-Bereich merkte er schmunzelnd an: „Wer Israel boykottieren will, landet in der Steinzeit.“
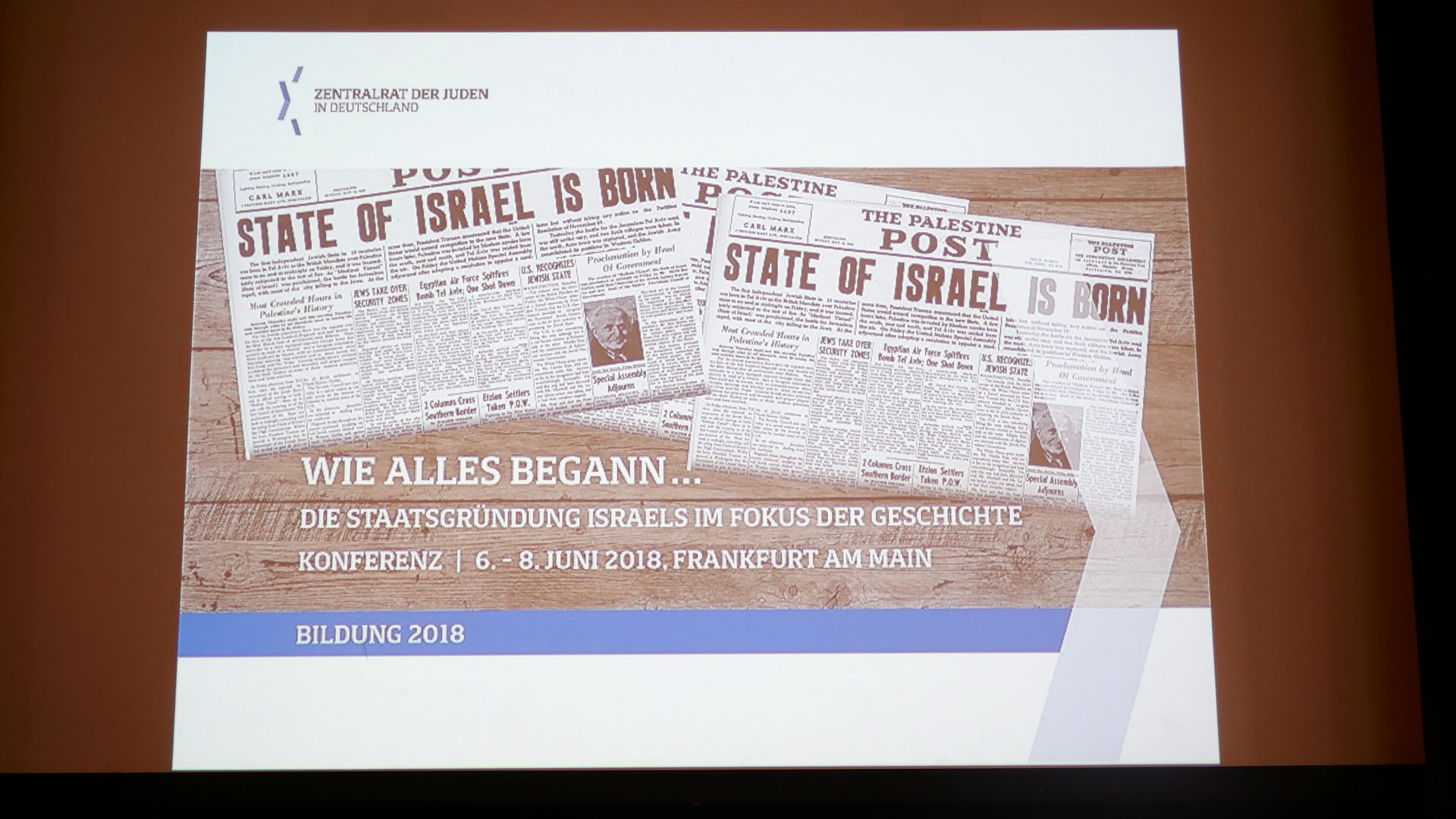 Foto: Israelnetz/Elisabeth Hausen
Foto: Israelnetz/Elisabeth HausenBereits am Mittwoch hatte sich die Tagung ausführlich mit Ben-Gurion befasst. Die dreitägige Konferenz in Frankfurt stand unter dem Titel: „Wie alles begann … – Die Staatsgründung Israels im Fokus der Geschichte“. Veranstalter war der Zentralrat der Juden in Deutschland. Die fachliche Begleitung hatte Johannes Becke von der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg.
Von: Elisabeth Hausen



