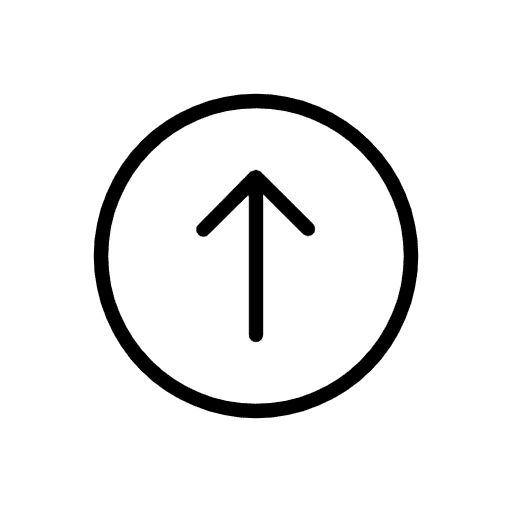"118 Mal haben Armeen um diese Stadt oder in ihr gekämpft, 44 Mal wurde sie erobert, 23 Mal belagert." Dieses Fazit zieht "Geo"-Autor Malte Henk für zwölf Monate Jerusalem. Genau ein Jahr lebt und arbeitet der Journalist in Tel Aviv. Jeder Versuch, im Nahen Osten Frieden zu schaffen, müsse mit Jerusalem beginnen, meint er.
Henk beschreibt das Schicksal einer palästinensischen Familie in im Ostjerusalemer Stadtteil Silwan, die von "bewaffneten Juden" aus ihrer Wohnung vertrieben worden sei. Tatsächlich war ihr Haus verkauft worden, und die Käufer waren Juden. "Bald war klar, dass der Verkäufer, ein Araber, als Strohmann für eine jüdische Organisation Wohnraum im Palästinenserviertel beschaffte." Andere jüdische Familien zogen ebenfalls in das Viertel. Wer das bereits für einen Skandal hält, kann wohl auch Henks Verwunderung darüber verstehen, dass die jüdischen Bewohner nur unter Polizeischutz ein normales Leben dort führen können. "Wie ein unsichtbarer Andreasgraben" verlaufe durch Jerusalem ein Riss zwischen Juden und Muslimen.
Aber die Opfer sind bei Henk hauptsächlich die Araber. Wenn Juden Palästinenser ermorden – und das passiert nach Henks Darstellungen offenbar sehr häufig -, halten die Behörden immer zu den Juden und erschweren den Prozess um Aufklärung und Gerichtsverhandlung.
"Wer siedelt wo?"
Henk gibt in einem kurzen Abriss die Geschichte des Staates Israel wieder, hütet sich aber davor, die alles entscheidende Frage eindeutig zu beantworten: Wem gehört das Land? Juden und Moslems lebten immer schon in diesem Land, als dann 1948 die arabischen Nachbarstaaten die Gründung eines israelischen Staates verhindern wollten und angriffen, war das Ergebnis laut Henk "teuflisch unklar": Jerusalem wurde geteilt wie Berlin, halb jüdisch, halb arabisch. Am 7. Juni 1967 dann der Sieg im Sechs-Tage-Krieg und die umjubelte Rückeroberung ganz Jerusalems.
Heute finde der Krieg in der Demographie statt: Wer siedelt wo, wie schnell wächst die Bevölkerung der jeweils anderen? Bei "Geo"-Autor Henk liegt das Problem auffällig oft auf der Seite der orthodoxen Juden, der Männer mit Schläfenlocken und den schwarzen Gewändern. Beispiele: "Sie gründen Synagogen in Privathäusern. Und ihre Rabbis haben durchgesetzt, dass im Kindergarten ein Zaun die spielenden orthodoxen von den spielenden säkularen Dreijährigen trennt", so Henk. Jüdische Aktivisten veröffentlichen die Namen von Geschäftsleuten, die Palästinensern Arbeit geben, "oder sie verteilen Gütesiegel an Restaurants, in denen keine Araber in der Küche stehen." Oder: "In den Krankenhäusern von Ost-Jerusalem wehren sich radikale Siedler manchmal dagegen, arabische Ärzte an sich heranzulassen. Der Jerusalemer Fußballclub Beitar gibt arabischen Spielern keine Verträge (…)", merkt der Journalist an.