JERUSALEM (inn) – Nach der Niederlage Nazi-Deutschlands galt es für Holocaust-Überlebende, ihr Leben aus den Trümmern aufzubauen. Am Mittwochabend entzündeten bei der zentralen Gedenkzeremonie zum Jom HaSchoa in Jerusalem sechs von ihnen Fackeln. Diese stehen für die rund sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden.
Die Veranstaltung in der Gedenkstätte Yad Vashem stand unter dem Thema: „Aus der Tiefe: Die Qualen der Befreiung und Wiedergeburt – 80 Jahre seit der Niederlage Nazi-Deutschlands“. Und so erzählten die Überlebenden in Videos, wie sie nach dem Ende des Krieges ein neues Leben aufgebaut hatten.
Den Anfang machte Arie Durst. Er stammt aus dem damals polnischen und heute ukrainischen Lwow (Lemberg oder auch Lwiw). Der Vater wurde von russischen Offizieren für die Rote Armee rekrutiert. Seinen Bruder verschleppten Deutsche bei einer der „Aktionen“ gegen Juden. Daraufhin fälschte die Mutter Dokumente. In Warschau gaben sie sich als polnische Christen aus. Später habe er festgestellt, dass er in dieser Zeit wie ein Schauspieler gehandelt habe, sagte Durst in dem Vorstellungsvideo.
Als der Krieg endete, war die Freude groß. Die Jewish Agency brachte ihn nach Israel, wo er seinen Vater wiedertraf. Durst kämpfte im Jom-Kippur-Krieg und eröffnete 1972 die erste Abteilung für Transplantationen im Jerusalemer Hadassa-Krankenhaus. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und acht Enkel – und ist nach eigener Aussage „sehr zufrieden“.
Im Jüdischen Krankenhaus eingesperrt
Aus Deutschland stammt Monika Barzel. Sie wurde 1937 im Jüdischen Krankenhaus in Berlin geboren. Der Vater floh nach England, die Mutter arbeitete, also zog die Großmutter sie auf. Diese wurde nach Theresienstadt deportiert und starb dort. Die Mutter fand Arbeit im Jüdischen Krankenhaus, wo sie mit der kleinen Monika unterkam. Sie durften das Gelände nicht verlassen und litten Hunger. Weil sie von Deportationen und Gräueltaten hörten, hatten sie große Furcht vor den Lagern. Für den Notfall hatte die Mutter sich mit Tabletten für einen möglichen Suizid versorgt.
Nach der Befreiung kam Monika Barzel mit ihrer Mutter über Schweden nach London. Dort studierte sie Zahnmedizin und wanderte 1963 nach Israel aus. Mit ihrem Ehemann Alan ließ sie sich im Kibbuz Kfar HaNassi nahe der syrischen Grenze nieder. Er starb mit 59 Jahren an Krebs. Sie haben zwei Kinder, sechs Enkel und ein Urenkelkind.
Felix Sorin erinnert sich bis heute an die deutsche Invasion der Sowjetunion. Er wurde 1932 im weißrussischen Mogilev geboren. Nach dem Einmarsch flohen Menschenmassen vor den Nationalsozialisten. Er verlor seine Familie aus den Augen, war mit neun Jahren auf sich allein gestellt. Mit einem Freund floh er aus dem Ghetto, wurde gefasst und nach Minsk zurückgebracht. Er gab sich als Russe aus und überlebte in einem russischen Waisenhaus. Als die Rote Armee Minsk befreite, empfand er große Freude – und ließ sich wieder als Juden registrieren.
Im Jahr 1953 traf er Ida. Die beiden heirateten, bekamen einen Sohn und eine Tochter. 1992 wanderten sie nach Israel ein. Seine Ehefrau ist mittlerweile verstorben. Sie haben je fünf Enkel und Urenkel.
In einem Kloster gut versorgt
Eine weitere Fackel entzündete die 1937 geborene Rachel Katz aus dem belgischen Antwerpen. Ihr Vater wurde von den Nazis verhaftet, die Mutter sagte der Gestapo auf Deutsch: „Ich bin nicht jüdisch.“ Das Mädchen kam in einem Kloster unter, wo es sehr gut behandelt wurden. Als nach drei Monaten Deutsche auch dorthin kamen, wollte die Nonne Rachel retten und brachte sie zur Mutter zurück. Sie lebten unter falscher Identität in einem nicht-jüdischen Viertel. Der Vater wurde in Auschwitz ermordet.
Mit 20 Jahren machte die heute 88-Jährige Alija. Bis heute unterstützt sie ehrenamtlich Überlebende. Sie hat zwei Kinder, drei Enkel und zwei Urenkel: „Sie sind meine ganze Welt.“
Arie Reiter wurde 1929 geboren. Mit elf Jahren erlebte er Pogrome in seinem rumänischen Heimatort Vaslui. Sein Vater kam in ein Arbeitslager, wo er 1943 starb. Arie wurde mit 13 zum Familienoberhaupt. Er und seine Brüder mussten ebenfalls Zwangsarbeit leisten. Nach dem Kriegsende war er überglücklich, zumal er seine Mutter wiedersah.
Im Jahr 1952 wanderte Reiter nach Israel ein und ließ sich in der Wüstenhauptstadt Be’er Scheva nieder. Er gründete ein Museum zur Erinnerung an das gesunkene Flüchtlingsschiff „Struma“, das 1942 versucht hatte, verfolgte Juden ins Mandatsgebiet Palästina zu bringen. Er hat fünf Kinder, 17 Enkel und mehrere Urenkel.
Kurzes Gebet für die Geiseln
Auch in Tunesien erlitten Juden während des Zweiten Weltkrieges Verfolgung. Gad Fartouk kam 1931 in Nabeul zur Welt. Als deutsche Truppen im November 1942 Tunesien besetzten, wurde sein Vater von der Polizei verhört. Die Familie zog nach Hamam-Lif und verbarg ihre jüdische Identität, sie betete nur noch zu Hause. In der Stadt Gabès kamen sie bei einem Onkel unter. Gad suchte im Abfall nach Essen. Dabei begleitete ihn neben dem Hunger die Angst vor Entdeckung.
Vor der Staatsgründung wanderte er 1948 mit einem italienischen Fischerboot nach Palästina ein. Es sei „wie nach Hause kommen“ gewesen, sagte Fartouk. Er gehörte zu den Gründern des Kibbuz Karima und war bis zu deren Tod 62 Jahre mit Mona verheiratet. „Heute bin ich ein glücklicher Mann“, resümierte er in dem Vorstellungsvideo. Er hat vier Kinder, 13 Enkel und acht Urenkel. „Das ist meine Rache für das Leiden, das von den Nazis verursacht wurde.“ Bevor er mit einem Verwandten die Fackel entzündete, sprach der Überlebende ein kurzes Gebet: „Mögen die 59 Geiseln schnell zurückkommen.“
Gemischte Gefühle nach Befreiung
Traditionell hält bei der Gedenkzeremonie ein Überlebender eine Rede im Namen der Leidensgenossen. In diesem Jahr übernahm das Eva Erben aus der damaligen Tschechoslowakei. Sie litt im Ghetto Theresienstadt, ihr Vater kam in Dachau zu Tode. Auf einem Todesmarsch starb die Mutter in ihren Armen. Ein Ehepaar versteckte sie.
In ihrer Ansprache sagte die Überlebende, die Befreiung von den Nationalsozialisten habe in ihr gemischte Gefühle ausgelöst. Sie habe lange auf das Kriegsende gewartet, doch in ihr ursprüngliches Leben konnte sie nicht zurückkehren. Mit 15 Jahren sei sie allein für ihr Schicksal verantwortlich gewesen.
Am 14. Mai 1948, als David Ben-Gurion die israelische Unabhängigkeitserklärung verlas, traf sie Peter. „Er brachte mich ins Leben zurück“, erzählte sie. Nach ihrer Hochzeit wanderten sie in den jüdischen Staat ein, sie lebten in der Küstenstadt Aschkelon.
Eva Erben hat erfahren: „Selbst aus der Hölle kann man aufstehen.“ Aus den Trümmern des Lebens habe sie eine Familie aufgebaut, auch der Staat Israel sei daraus entstanden. Die Überlebende bekannte trotzig: „Selbst wenn ich weiß, dass morgen die Welt untergeht, pflanze ich heute einen Baum in Eretz Israel.“ Daran könnte sie auch der Antisemitismus nicht hindern.
Überlebender spricht Gebet
Der aschkenasische Oberrabbiner Kalman Ber las passende Psalmverse. Sein sephardischer Kollege David Josef sprach das Kaddisch-Gebet im Gedenken an die Toten.
Zur Zeremonie gehört auch das Gebet „El Male Rachamim“ (Gott voller Erbarmen). In diesem Jahr trug es ein Überlebender der Schoa vor, Jehuda Hauptmann. Er war mit seiner Familie aus der Tschechoslowakei nach Ungarn geflohen. Sie erhielten schwedische Schutzpässe. Nach dem Krieg errichtete er sein neues Haus in Tekuma nahe der Grenze zum Gazastreifen. Dort überlebten er und seine Frau Jehudit am 7. Oktober 2023 das Terrormassaker der Hamas. Sie haben sechs Kinder, 23 Enkel und zehn Urenkel.
Herzog: Überlebende sehnen sich nach Einheit
Der israelische Staatspräsident Jizchak Herzog appellierte einmal mehr an das gespaltene Volk. Er empfange regelmäßig Holocaust-Überlebende in seiner Residenz, sagte er in der Rede. Alle hätten eine Forderung: „Die Spaltung zwischen uns ist furchtbar. Sorgen Sie für Einheit im Volk.“
Die Israelis sollten die heiligen Gedenktage zu Tagen der nationalen Verantwortung machen – und sich vereinen zum Schrei und Gebet, dass alle Geiseln zurückkehren mögen. Sie sollten gemeinsam beten für das Wohl der Soldaten und die Heilung aller Verletzten.
„Wir gedenken der Opfer – und begehen gleichzeitig den Sieg: den Triumph des Lichtes über die Finsternis, der Moral über das schrecklichste Übel, des menschlichen Geistes – des jüdischen Geistes – über ungeheuerlichen Hass.“ Dabei gehe der Blick nicht nur zurück. Die Zeremonie finde nicht nur 80 Jahre nach der Schoa statt, sondern auch anderthalb Jahre nach der furchtbarsten Katastrophe, die das jüdische Volk seitdem getroffen habe. „Wir werden es auch diesmal bewältigen.“
Netanjahu zitiert Scholz
Regierungschef Benjamin Netanjahu (Likud) verspätete sich wegen einer verdächtigen Drohne, die sich als ungefährlich herausstellte. In seiner Ansprache sagte er, die Überlebenden symbolisierten „den Heldenmut, der unsere Existenz bedeutet“. Er zitierte Olaf Scholz (SPD), der nach dem 7. Oktober Israel besucht hatte. Der deutsche Bundeskanzler habe den Film über die Gräueltaten des Massakers gesehen und ihm gesagt: „Die Mörder der Hamas sind genau wie die Nazis.“
Vor einem Jahr hätten Vertreter der internationalen Gemeinschaft Israel mit einem Waffenembargo gedroht, falls die Armee nach Rafah einmarschiere. Doch „als Premierminister Israels, des Jahrtausende alten Staates der Juden, werde ich nicht die Hand niederlegen. Niemand wird uns aufhalten. Wenn wir allein kämpfen müssen, werden wir allein kämpfen. Wenn wir mit den Fingernägeln kämpfen müssen, werden wir mit den Fingernägeln kämpfen“, ergänzte Netanjahu. Dank der Operation in Rafah habe sich die Armee des Philadelphi-Korridors bemächtigt und den Hamas-Führer Jahja Sinwar getötet.
Der Kampf gegen die Hamas werde weitergehen, versprach der Regierungschef. Israel werde alle Geiseln heimholen, die Hamas besiegen und verhindern, dass der Iran Atomwaffen erlange.
Gebet für Geiseln und Nationalhymne in Auschwitz
In der KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau in Polen sprach unterdessen eine besondere Gruppe ein Gebet für die Geiseln. Daran beteiligten sich im einstigen Krematorium Überlebende der Schoa, ehemalige Geiseln und Angehörige von Israelis, die sich noch in den Händen der Hamas befinden. Sie beteten auch um Schutz für die israelischen Soldaten. Anschließend sangen sie gemeinsam die israelische Nationalhymne.
Die Gruppe gehört zu den Teilnehmern des „Marsches der Lebenden“. Dafür kommen jedes Jahr am Jom HaSchoa Überlebende und vor allem junge Juden aus aller Welt nach Auschwitz. Sie marschieren nach Birkenau und vollziehen damit den Weg nach, den die Häftlinge im Vernichtungslager zu den Gaskammern zurücklegten. (eh)

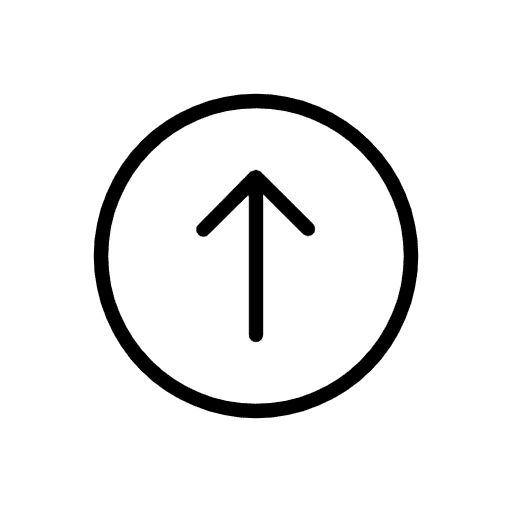


2 Antworten
Wenn der Tunesier Gad Fartouk sagt „heute bin ich ein glücklicher Mann“ und Eva Erben sagt „selbst aus der Hölle kann man sufstehen“, dann sind das sehr ermutigende Aussagen. Ja, das jüdische Volk wird es auch diesmal wieder bewältigen. Aber Herzog hat auch Recht: „Die Spaltung zwischen uns ist furchtbar. Sorgen Sie für Einheit im Volk.“
Das Bäume pflanzen in Erez Israel kann man übrigens auch von hier aus. 🌳🇮🇱🎗🙏
ntv Nachrichten 02.11.2023
Wer in Tunesien das „Verbrechen der Normalisierung“ der Beziehungen zu Israel begeht, riskiert künftig eine lange Haftstrafe. Jede Art der Kommunikation soll als „Hochverrat“ gelten. Der Parlamentspräsident ruft indes indirekt zur Auslöschung Israels auf.