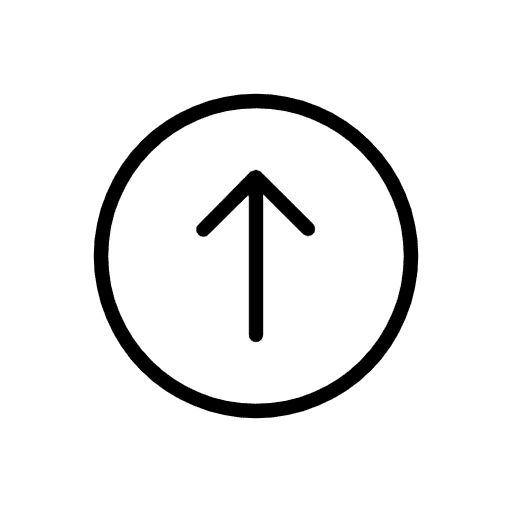Eine der ersten Fragen, die eine Mutter nach der Geburt in Deutschland bekommt, lautet: „Wie heißt das Baby?“ Auch auf dem Erkennungsband, das an der Hand des Neugeborenen befestigt wird, steht schon der Name. In Israel ist das anders. Auf dem Band an der Hand oder am Fuß des Babys steht der Name der Mutter. Ein jüdischer Junge bekommt seinen Namen am achten Tage, wenn er durch die Beschneidung in den Bund Abrahams aufgenommen wird. Und auch bei einem Mädchen lassen sich die Eltern mit der Namengebung Zeit.
Hebräische Namen haben eine Bedeutung oder erinnern an eine Persönlichkeit. Je nach dem, wie die Geburt verlaufen ist, die Umstände davor und danach waren, oder auch was vom Charakter des Kindes in der kurzen Zeit sichtbar wird, wird der Name ausgewählt. Jüdische Eltern haben so nach der Geburt erst einmal die Möglichkeit, ihr Kind zu beobachten, um den passenden Namen zu finden – außer er wurde bereits durch die Familientraditionen oder Gott selbst bestimmt, wie das beispielsweise bei Johannes dem Täufer der Fall war. Darüber berichtet der Evangelist Lukas (1,59f): „Und es begab sich am achten Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden, und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber seine Mutter antwortete und sprach: Nein, sondern er soll Johannes heißen.“
„Brith Milah“ wird die Beschneidung auf Hebräisch genannt; der Bund Abrahams. Gott selbst war Abraham im Alter von 99 Jahren erschienen und hatte ihm geboten: „Ich bin der allmächtige Gott; wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren… Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden; eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Jedes Knäblein, wenn’s acht Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen… Und so soll mein Bund an eurem Fleisch zu einem ewigen Bund werden“ (1. Mose 17,1-2.10-13).
Jahrtausende hindurch hat sich das jüdische Volk an diesen Bund gehalten. Zur Zeit des Alten Testaments wurde die Beschneidung mit einem Steinmesser ausgeführt. Der Flint, den man im Negev und im Sinai findet, eignet sich besonders gut dazu, weil er rasiermesserscharf und, wenn man ihn unmittelbar vor dem Gebrauch erst schlägt, steril ist.
Zippora, die midianitische Frau Moses, rettete ihren Mann vor dem Zorn Gottes, indem sie schnell nach einem scharfen Stein griff und ihren Sohn beschnitt (2. Mose 4,24-25). Josua bekam in Gilgal vor dem Einzug in das gelobte Land von Gott die Aufgabe, die ganze Generation, die unterwegs in der Wüste nicht beschnitten worden war, zu beschneiden (Josua 5,2-8). In Zeit des Abfalls unter der Herrschaft des israelitischen Königs Ahab und seiner heidnischen Frau Isebel eiferte der Prophet Elia für den Herrn und beklagte, dass Israel seinen Bund verlassen hat (1. Könige 19,10.14). In Erinnerung daran wird bis heute der Beschneidungsstuhl in Synagogen traditionell „Stuhl des Elia“ genannt.
Elia hat im Judentum eine besondere Stellung als Zeuge und Vorgänger des Messias. Auch beim Passafest steht ein gedeckter Platz am Tisch für ihn bereit. Im Neuen Testament kommt diese Elia-Erwartung zum Ausdruck, wo nicht nur Johannes der Täufer von Jesus als Elia identifiziert wird, sondern er auch gemeinsam mit Mose bei der Verklärung Jesu auftritt (Matthäus 11,14; 17,3).
Unter dem Einfluss des Hellenismus ließen Juden im 2. Jahrhundert vor Christus durch schmerzhafte Operationen ihre Vorhaut wieder herstellen, um an den heidnischen Spielen teilnehmen zu können. Das 2. Makkabäer-Buch (6,10) berichtet andererseits, wie unter der Herrschaft des Seleuzidenherrschers Antiochus II. Epiphanes zwei Frauen getötet wurden, weil sie ihre Söhne beschnitten hatten: „Denen band man die Kindlein an die Brust und führte sie öffentlich herum durch die ganze Stadt und warf sie zuletzt über die Mauer hinab.“
Bis heute ist die Beschneidung ein fester Bestandteil des jüdischen Lebens. Auch die säkulare Bevölkerung Israels hält daran fest. Beschneidungen werden von einem „Mohel“ durchgeführt, einem jüdischen Mann, der durch eine Urkunde seine Ausbildung nachweisen kann und außerdem das Vertrauen der Gemeinde besitzt. Die antiken Steinmesser wurden durch sterile Instrumente ersetzt, zu denen neben einem Skalpell auch eine Klammer und ein Gläschen zum Blutabsaugen gehören. Normalerweise hält der „Sandak“, der Pate, das Kind zur Beschneidung auf dem Schoß, nachdem schon am Morgen des Beschneidungstages in der Synagoge bestimmte liturgische Passagen gesungen wurden.
Früher fand die Beschneidung oft in der Synagoge statt. Man benützte für den Paten und für den Mohel besondere Sessel mit bestickten Kissen, die „Jidsch-Stühle“ und die „Jidsch-Kissen“. Heute wird die Beschneidung auch zu Hause ausgeführt. Das Haus ist festlich vorbereitet und das Baby wird besonders hübsch angezogen. Wenn es hereingebracht wird, sagen alle Anwesenden: „Baruch Haba – Gelobt sei der, der da kommt“ (Psalm 118,26). Der Mohel betet: „Gelobt seiest du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der du uns geheiligt durch deine Gebote und uns die Beschneidung befohlen.“ Nach dem die Vorhaut abgeschnitten ist, sagt der Vater des Kindes: „Gelobt seiest du, Ewiger unser Gott, König der Welt, der du uns geheiligt durch deine Gebote und uns befohlen, den Sohn in den Bund unseres Vaters Abraham aufzunehmen.“
Nach der Beschneidung bekommt das Kind seinen Namen, der feierlich verkündet wird. Unter anderen Segnungen wird auch der biblische Spruch aus Hesekiel 16,6 über dem Kind gesagt: „Ich sprach zu dir, als du so in deinem Blute dalagst: Du sollst leben!“ Die alttestamentlichen Propheten erklärten die fleischliche Beschneidung als Bund mit Gott, der einer geistlichen Einstellung des Herzens entsprechen sollte: „Darum spricht Gott der Herr: Es soll kein Fremder mit unbeschnittenem Herzen und unbeschnittenem Fleisch in mein Heiligtum kommen“ (Hesekiel 44,9).
Natürlich wird die Beschneidungspraxis innerhalb des Judentums diskutiert und vor allem von Seiten der Reformjuden hinterfragt. Manche betrachten die Beschneidung als unnötig oder sogar als Misshandlung. Aber wenn Gegner der Beschneidung meinen, „man würde doch auch nicht ein Stück vom Ohr abschneiden“, wäre auch das noch nicht einmal unbiblisch, wenn man bedenkt, wie sich der Prophet Jeremia beklagt: „Dass doch jemand hören wollte! Aber ihr Ohr ist unbeschnitten; sie können’s nicht hören. Siehe, sie halten des Herrn Wort für Spott und wollen es nicht haben“ (Jeremia 6,10). Auch Stephanus bezeichnete in seiner Verteidigungsrede vor seinem Tod seine Verfolger als „unbeschnitten an Herzen und Ohren“ (Apostelgeschichte 7,51).
Der holländische Rabbiner Simon Philip De Vries (1970-1944) schrieb vor dem Zweiten Weltkrieg: „Es soll keineswegs verneint werden, dass frühere Generationen es besser verstanden haben, um der Milah willen auch schreckliche Opfer zu bringen, als die an Freiheit und Wohlstand gewöhnte heutige Generation zu ertragen vermag.“ Er meinte dann allerdings auch zu verstehen, warum gerade an dieser Stelle: „Dort, wo es als heiliges und intimes Zeichen für die Weihung des Lebens dienen wird; dort, wo es für immer daran erinnern wird, dass selbst der grundlegendste tierische Akt der Fortpflanzung auf einen göttlichen Befehl zurückgeht, wo es als lebenslange Warnung dient vor den Gefahren der Ausartung und Verderbtheit.“ Das stärkste Argument orthodoxer Rabbiner für die Beschneidung ist aber immer noch, dass es sich um ein biblisches Gebot handelt.