Ein Experten-Team hat mit einem Künstler die antike Bronzestatue des römischen Kaisers Hadrian im Garten des Israel-Museums mit der emsigen Unterstützung zehntausender Bienen in Waben nachgebildet. Während Hadrian (76–138) im Westen als aufgeklärter Kaiser und begabter Herrscher, Philosoph und Dichter angesehen wird, gilt der Römer in der jüdischen Geschichtsschreibung als Unterdrücker des jüdischen Volkes.
Publius Aelius Hadrianus, so lautet sein vollständiger Name, schlug brutal den Bar-Kochba-Aufstand (132–135 nach der Zeitrechnung) nieder, vernichtete die jüdische Bevölkerung in Judäa und gab der Region als Rache für die Schmach, die er durch die Juden erlitten hatte, einen neuen Namen: Palästina. Hadrian wählte bewusst den Namen von Israels Erzfeind, den Philistern. Die lateinische Aussprache von „Philister“ ist „Palästinenser“, auf das Land bezogen „Philistäa“ beziehungsweise „Palästina“.
Die Bronzestatue ist eine von weltweit nur drei existierenden Bronzestatuen des römischen Kaisers Hadrian und ständiges Exponat in der Dauerausstellung des Museums. Sie wurde im 2. Jahrhundert im in der Antike geläufigen Wachsausschmelzverfahren gegossen, bei dem Bienenwachs als Modell für das Bronzeporträt diente. Die beiden anderen Bronzestatuen dieses ungewöhnlichen Projektes waren Leihgaben des Britischen Museums und des Pariser Louvre. Sie unterscheiden sich voneinander nur geringfügig in ihrer Darstellung des Kaisers.
Gerechter versus brutaler Herrscher
Hadrian regierte das Römische Reich von 117 bis 138 nach Christus und wurde von zeitgenössischen römischen Historikern als einer der fünf guten Kaiser verehrt: ein gerechter Herrscher, ein Friedensstifter und großer Architekt des Reiches. Die Mauer entlang der Grenze zu Schottland trägt seinen Namen.
Im jüdischen Gedächtnis ist Hadrian vor allem eins: brutaler und tyrannisch. Nach der Niederschlagung des Bar-Kochba-Aufstandes im Jahr 135 ließ er Hunderttausende Juden abschlachten und benannte Jerusalem in Aelia Capitolina um. Die Umbenennung leitet sich zum einen von Hadrians Gentilnamen Aelius, dem Sippennamen, ab und bezieht sich zum anderen auf Iuppiter Optimus Maximus, Jupiter, den obersten Gott des römischen Pantheons.
Während es Hunderte von in Marmor gemeißelten Darstellungen von Hadrian gibt, sind die drei hier erwähnten Statuen die einzigen in Bronzen, die aus der Antike erhalten geblieben sind. Die Büste, die in Tel Schalem in der Nähe der nordisraelischen Stadt Beit Schean gefunden wurde, ist mit Abstand die lebensechteste der drei: Der Kaiser trägt eine prächtige Kürass-Rüstung mit einer Kampfszene auf der Brust, Vollbart, das Gesicht und seine Gesichtszüge wirken im fortgeschrittenen Alter weicher.
Auf seinen Ohrläppchen befinden sich zwei diagonale Falten. Ärzte vermuten, das diese Falten Anzeichen für eine Herzkrankheit sind, an der Kaiser Hadrian im Alter von 60 Jahren möglicherweise gestorben ist.

Die außergewöhnlich hohe Materialqualität der Statue ließ Archäologen den Rückschluss ziehen, dass die Büste möglicherweise in Rom oder in einem anderen wichtigen Zentrum des Römischen Imperiums gefertigt wurde. Das antike Wachsausschmelzungs-Verfahren findet Nachahmung in den Arbeiten des Designers Tomáš Libertíny. Der slowakische Künstler stellt mit Honigbienen Wachsskulpturen her.
Das Team des Israel-Museums baute unter fachmännischer Anleitung von Libertíny Bienenstöcke, um zwei Nachbildungen des Kaiserkopfes unterzubringen. Jede Replik basierte auf einem High-Level-Scan des Originals und enthielt ein 3D-gedrucktes Gitternetz aus sterilem, bienenfreundlichem Nylon, das die Aktivität der Bienen förderte. Anschließend wurden die Bienenstöcke im Außengarten des Museums aufgestellt, wo schätzungsweise eine halbe Million Bienen aktiv sind.
Tomáš Libertíny lebt und arbeitet hauptsächlich im niederländischen Rotterdam. In seiner Heimat studierte er an der Technischen Universität Košice mit Schwerpunkt auf Ingenieurwesen und Design, erhielt ein Stipendium des Open Society Institute von George Soros, um an der Universität Washington in Seattle zu studieren. Dort konzentrierte er sich auf Malerei und Bildhauerei. Zurück in seiner Heimat, setzte der Slowake sein Studium in Bratislava an der Akademie für Bildende Künste und Design in den Bereichen Malerei und konzeptionelles Design fort.
Dirigent eines natürlichen Orchesters
Libertínys Faszination für die Schönheit und Intelligenz der Natur verleiht seinen Arbeiten eine universelle Sprache. Die Beziehung zwischen Mensch und Natur, sowohl psychologisch als auch physisch, ist eine ständige Quelle der Inspiration für den Künstler und Designer.
Libertíny betrachtet sich selbst als Dirigent eines natürlichen Orchesters, repräsentiert von Bienen. Der Künstler zieht sich aus der Produktion der Werke zurück und lässt zeitgenössisches Design und Technologie mit der kollektiven Intelligenz eines Bienenvolkes verschmelzen.
Folgen Sie uns auf Facebook und X!
Melden Sie sich für den Newsletter an!
Kuratoren für Design und Archäologie erkannten Libertínys Expertise. Dank ihrer konnte die antike Wachsausschmelzungs-Technik der Hadrian-Statue in Kooperation mit dem Künstler rekonstruiert und die Büste nachgebildet werden.
Unter Mitwirkung des erfahrenen israelischen Imkers Rafi Nir stellten Libertíny und die Kuratoren Bienenstöcke im Kunstgarten des Israel-Museums auf. In ihnen befanden sich 3D-gedruckte Netzmodelle der Statue; interne Kameras verfolgten 100.000 Bienen, während sie Waben auf Hadrians Kopf bauten. Das rekonstruierte Porträt bietet einen neuen Blick auf ein einzigartiges Exponat in der archäologischen Ausstellung des Museums.

Die Wachsausschmelzungs-Technik ist eine alte Metallgussmethode, bei der geschmolzenes Metall in eine Hohlform gegossen wird, die über einem Bienenwachsmodell erstellt wurde. Es schmilzt während des Prozesses. Das aktuelle Projekt zielte darauf ab, die Bienenwachsmodelle nachzubilden. Es scheiterte kurz vor dem nächsten Schritt, dem Eingießen des geschmolzenen Metalls.
„Die Bienen haben eine Phase nachgebildet, die wir in der Archäologie nie haben, weil sich das Wachs aufgelöst hat. Sie haben den fehlenden Teil nachgebildet“, erläutert Dudi Mevorah, leitender Kurator für hellenistische, römische und byzantinische Archäologie am Israel-Museum Jerusalem.
„Der Ansatz ist, dass man die direkte Kontrolle verliert. Leben und Kunst sollten nicht so streng regiert werden. Als Künstler bin ich der Natur ausgeliefert. Meine Stärke beruht jedoch auf einem fundierten Verständnis davon, wie Bienen leben und arbeiten. Es ist dieses Wissen, das es mir ermöglicht, kreatives Potenzial behutsam auszuschöpfen … Ich werde mehr zum Dirigenten eines Orchesters und stelle sicher, dass alle individuellen Stärken in Harmonie und nicht in Kakophonie fließen“, erläutert Tomáš Libertíny sein Verständnis von Kunst. Die neu geschaffenen Wachsstatuen wurden aus den Bienenstöcken entfernt, bevor die Honigproduktion ihre Erhaltung gefährden konnte.

Hadrians Wabenskulptur verbindet historisches Wissen mit der zeitgenössischen Rolle des Museums: Vergangenheit und alte Techniken werden bewahrt unter gleichzeitiger Auseinandersetzung mit dringenden sozialen und ökologischen Fragen. Das Projekt fördert einen ökozentrischen Ansatz, auch in der Praxis, denn im Kunstgarten des Museums sind die Bienenstöcke Teil der Landschaft geworden.
Das Hadrian-Projekt will auch ein größeres Bewusstsein für die Bedeutung von Bienen und Biodiversität schaffen. Erfreulicherweise wurde an einigen Orten die städtische Bienenzucht auf Dächern und Hinterhöfen aufgegriffen, so auch im Garten der Knesset und im Botanischen Garten von Jerusalem. Liebhaber können im Israel-Museum geimkerten Honig aus diesem einzigartigen Projekt erwerben.

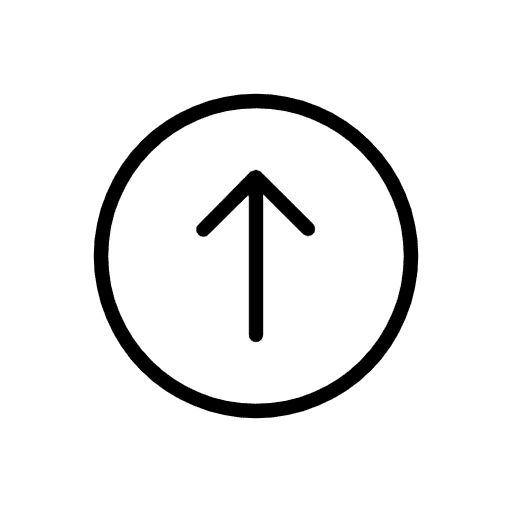





4 Antworten
Danke für den Bericht. Und man erfährt erneut etwas zur Entstehung des sog. „Palästina“.
Das sollte vielen Menschen zu denken geben.
Sehr interessant, dass Gott sein Volk durch die Philister bestrafte.“
„Gott benutzte sie auch, um sein schuldiges Volk zu bestrafen“ (Bibelkommentare)
Jahwe wartet darauf, dass Israel das Gesprächsangebot Gottes annimmt (Jes. 1,18ff)
Lieber Gruß Martin
Danke für den Artikel. Schützen wir die Bienen und unsere Umwelt. ❤
Auch ich möchte mich für diesen Bericht bedanken. Hab wieder etwas gelernt zur Entstehung Palästinas. Da wird einem vieles klar! Und durch Bienen kommt das Thema zustande. Sehr gut!!! 🐝 Und es wird noch lecker Honig produziert! 😉🍯