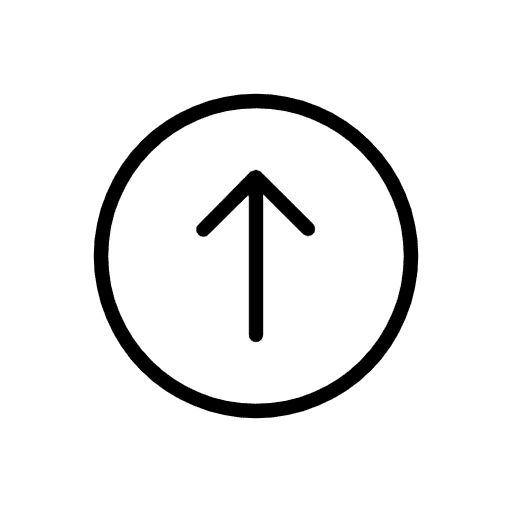Theodor Se’ev Herzl (1860-1904) ist bekannt als Vater des politischen Zionismus. Kaum mehr als hundert Jahre nach seinem Tod will man sich jetzt in Israel neu auf den Wiener Journalisten besinnen. In Jerusalem wurde deshalb dieser Tage auf dem Herzl-Berg, wo Herzl seit 1949 begraben liegt, ein renoviertes Herzl-Museum eingeweiht. Das israelische Parlament hat 2004 einen Herzl-Tag beschlossen, der künftig jedes Jahr am hebräischen Geburtstagsdatum Herzls begangen werden soll, dem 10. Ijar, eine Woche nach dem Unabhängigkeitstag. Und Das Goethe-Institut bot aus aktuellem Anlass ein hebräisch-deutsches Kolloquium zur Herzl-Forschung an.
Zweifellos war der promovierte Jurist derjenige, der die Frage eines eigenen Staates für das jüdische Volk im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts auf die Bühne des politischen Europas hievte. Unbeirrt von Ablehnung und Spott bereiste er Europa und den Vorderen Orient, um den gekrönten Häuptern und Mächtigen seiner Welt klar zu machen, dass es nur eine Lösung für das Problem des Antisemitismus gibt: Einen unabhängigen Judenstaat. Die romantische Programmschrift „Der Judenstaat“, der Roman „Altneuland“ und seine Tagebücher sind die wesentlichen literarischen Hinterlassenschaften Theodor Herzls.
Monica Selingher, Direktorin des Herzl-Museums, bemüht sich, die Relevanz Herzls für die moderne israelische Gesellschaft zu erklären – was ihr offensichtlich nicht leicht fällt. Sein historischer Verdienst bleibt unbestritten. Aber was hat Dr. Herzl mit seiner eher verschrobenen Persönlichkeit und einer gescheiterten Ehe jungen Israelis auf Identitätssuche zu bieten? Die grundlegende These, dass ein Judenstaat das Problem des Antisemitismus beseitigen werde, kann nach fast sechs Jahrzehnten realer Existenz desselben nur als gescheitert bezeichnet werden – womit in keiner Weise bestritten sei, dass sich das jüdische Volk mit Hilfe eines eigenen Staates sehr viel effizienter gegen seine Feinde wehren kann.
Mit dem traditionellen Judentum wusste Theodor Herzl nicht allzu viel anzufangen. Ursprünglich hatte er gar eine Massenkonversion zum Christentum als Lösung für den Antisemitismus vorgeschlagen. Erst der Dreyfus-Prozess im Januar 1895, bei dem Herzl als Korrespondent der Wiener „Neuen Freien Presse“ in Paris miterlebte, wie der Mob „Tod den Juden“ brüllte, bewirkte in ihm das Bewusstsein, dass auch der assimilierteste Jude immer als Jude von Judenhassern verfolgt werden wird.
Auch das biblische Land Israel war für den säkularen Journalisten nicht automatisch die natürliche Heimstätte für das jüdische Volk. Erst nachdem sich die Optionen Argentinien und Uganda nicht durchsetzen ließen, fügte er sich dem Ziel eines Judenstaates im damals osmanischen Palästina.
Zweifellos hatte Theodor Herzl Charisma. Rabbiner und christliche Theologen ließen sich zu messianischer Terminologie und Vergleichen mit Mose hinreißen – wenngleich die Mehrheit des orthodoxen Judentums eher Parallelen mit dem Pseudo-Messias des 17. Jahrhunderts, Schabtai Zvi, zu erkennen glaubte, der seine Nachfolger ins Unglück führte und letztendlich zum Islam konvertierte.
Legendär ist Herzls Tagebucheintrag vom 5. September 1897, in dem er seinen Rückblick auf den ersten Zionistenkongress in Basel beschreibt: „Fasse ich den Baseler Kongress in ein Wort zusammen – das ich mich hüten werde, öffentlich auszusprechen – so ist es dieses: in Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sagte, würde mir ein universelles Gelächter antworten. Vielleicht in fünf Jahren, jedenfalls in fünfzig wird es jeder einsehen.“
Herzls Vorstellungen von einer „vorbildhaften Gesellschaft“ scheinen jungen Israelis im Jahre 2005 ebenso wenig attraktiv – wenn man an ihr oftmals alles andere als vorbildhaftes Verhalten bei Auslandsaufenthalten denkt – wie seine Bewunderung für deutsche Organisation. Im Oktober 1898 hatte der österreichisch-ungarische Jude nach einer Begegnung mit Kaiser Wilhelm II. in Jerusalem seinem Freund, dem Großherzog von Baden anvertraut: „Wir brauchen ein Protektorat – das deutsche wäre uns… das liebste.” Später erklärte er dann dazu: „Unter dem Protektorat dieses starken, großen, sittlichen, prachtvoll verwalteten, stramm organisierten Deutschland zu stehen, kann nur die heilsamsten Wirkungen für den jüdischen Volkscharakter haben“, den er aufgrund der Jahrhunderte in der Diaspora für deformiert hielt.
Vielleicht sind es Herzls ungebremste romantisch-nationalistische Vorstellungen, die noch am ehesten attraktiv für junge Israelis sein könnten, die oft sehr unter dem „Besatzerimage“ leiden. Aber auch an Israel ist die Erkenntnis, dass der Nationalismus für die europäische Katastrophe im 20. Jahrhundert eine entscheidende Mitverantwortung trägt, nicht gänzlich vorübergegangen. Grundsätzlich wird die Mehrheit der israelischen Bevölkerung den Vorstellungen des Zionistenvaters zu einem Zusammenleben von Juden und Arabern entgegenhalten, dass heute – mehr als ein Jahrzehnt nach Oslo – auch in dieser Beziehung eher mehr Realitätssinn als mehr Idealismus gefragt ist.
Wer mit der Frage nach einer Botschaft für das heutige Israel das neue Herzl-Museum, in das circa 3 Millionen Euro investiert wurden, besucht, wird enttäuscht werden. Trotzdem lohnt sich ein Besuch der aufwendig-langatmigen Multimediashow in vier düsteren Räumen. Historische Gegenstände – Herzls original Küchenschrank mit Schreibutensilien, an dem „Der Judenstaat“ geschrieben wurde, sein Biedermeier-Arbeitszimmer, Souvenirs und der Tropenhelm, den er 1898 auf seiner Palästinareise trug – sind genauso lehrreich und interessant wie die vielen historischen Aufnahmen und die Nachstellung des 1. Zionistenkongresses mit von innen beleuchteten Figuren in Lebensgröße. Dafür kann man dann auch die eher platt und „sowjetisch“ anmutende Propaganda im letzten Teil über sich ergehen lassen. Außerdem ist die Darstellung Theodor Se’ev Herzls alles andere als unkritisch gegenüber der Gründerpersönlichkeit des politischen Zionismus.
(Bild: Johannes Gerloff)