Itamar Koller ist der Held des Romans „Itamar K.“ von Iddo Netanjahu. Itamar ist ein israelischer Musiker und Künstler, der nach einem langjährigen Auslandsaufenthalt in Amerika in den frühen 1990ern nach Israel zurückkehrt. Koller hat ein Filmmanuskript in der Tasche, das er erwartungsvoll beim entsprechenden Fördergremium, der fiktiven Nationalakademie für die Förderung vorbildlicher Kunst, einreicht. Das von Itamar vorgeschlagene Drehbuch handelt von dem in Israel weitgehend unbekannten, aber im westlichen Ausland gefeierten israelischen Konzertsänger Shaul Melamed.
Nach und nach lernt Koller die verschiedenen Akademiemitglieder und deren soziales und künstlerisches Umfeld kennen. Diese Tel Aviver Kaffeehaus-Szene wirkt wie eine Neuauflage der europäischen Bohème des frühen zwanzigsten Jahrhunderts, wenn auch von entschieden geringerer künstlerischer Qualität. Zunehmend erlebt K. absurde Situationen.
Der Romantitel „Itamar K.“ ist somit eben diesem Anklang an die Absurdität geschuldet, wie sie vielen Lesern von Frank Kafkas Werk Der Prozess (1925) und dessen Protagonisten Josef K. bekannt ist. Während der Israeli Koller von den Akademiemitgliedern immer wieder positive und sogar enthusiastische Kommentare zu seinem Drehbuch hört, wird das Filmprojekt inhaltlich zerrissen und abgelehnt. Während er immer neu auf die Förderungszusage vertröstet wird, ihm immer neue Änderungen und Überarbeitungen vorgeschlagen werden, zu denen er sich nach und nach erweichen lässt, wird er von der Akademie doch nur hingehalten.
Konzertierte Aktion gegen den Drehbuchautor
Diese Zeit wiederum nutzen die Akademiemitglieder bestens, um Itamars Filmidee für sich zu vereinnahmen. Letztendlich verwirklichen sie ihren eigenen Film ohne Erwähnung des Ideengebers oder eine entsprechende Entlohnung.
Presse und Kulturkritik erweisen sich dabei als fester Bestandteil dieser konzertierten Aktion, den Drehbuchautor, sein Projekt und seinen Filmhelden zu desavouieren, indem sie Itamars Vertrauen ausnutzen. So muss dem verstörten Itamar ein Freund erklären: „Wie gesagt, die Wahrheit als solche interessiert sie [die Journalisten] überhaupt nicht. Sie flechten Fakten in ihre aus den Fingern gesogenen Artikel hinein, damit sich ein gewisser roter Faden durch ihre Texte zieht und um die Auflage zu steigern. Die Massenmedien haben eine große gesellschaftliche Verantwortung, aber sie werden ihr nicht gerecht.“
Dabei zeichnen die Zeitungen und der neue Filmproduzent zielgerichtet und mit sehr kreativen Interpretationen biographischer Wirklichkeit ein entstellendes Bild des Autors und des historischen Lebens des Filmhelden. So konfrontiert sich Itamar mit dem zynischen Gedanken: „Bald würden sie [die Filmemacher und Zuschauer] wieder einen Nachschlag erhalten, und wenn der Film enden und die Lichter im Saal wieder angehen würden, da würden sie eine gerechte Verachtung empfinden für diesen Unmenschen Melamed.“
Entfremdung von der Heimat
Zuletzt muss Itamar Fernsehgebühren bezahlen, ohne überhaupt ein Gerät zu besitzen – eine Absurdität der alltäglichen Bürokratie, die allerdings auch manchem Bürger Deutschlands bekannt sein mag. Möglicherweise ist diese Schlussszene symbolisch für seine künstlerischen Anstrengungen zu verstehen, die anderen Ruhm und Erfolg bringen, für Koller selbst jedoch ergebnislos verpuffen.
Itamar kannte sein musikalisches Vorbild und den späteren Filmhelden Melamed lange Jahre bis zu seinem Tod, hatte freundschaftlichen Umgang mit ihm in New York und vorübergehend auch romantischen Kontakt zu dessen Witwe. Zusammen mit dieser beschließt er, noch wohnhaft in New York, dem Andenken an den verehrten Musiker eine künstlerische Filmbiographie zu widmen. Melamed hatte eine überragende persönliche und musikalische Bedeutung für Itamars Leben und Musik, so dass er zu keinem Zeitpunkt die meist nur verhalten und kryptisch vorgebrachte Kritik der Akademiemitglieder an seinem Drehbuch und dem filmischen Gedenkprojekt nachvollziehen kann.
Noch bedeutsamer und tragischer ist jedoch sein Unvermögen, zu verstehen, dass sich während seiner Abwesenheit von der israelischen Heimat die Kulturszene dort vom Zionismus abgewandt hat. Bei seiner Rückkehr nach Israel ist sie von einem postzionistischen ideologischen Paradigma geprägt, das viele vormals selbstverständliche zionistische Positionen geradeheraus ablehnt.
Arafat als Held der israelischen Kulturszene
Verstärkt wird der Schock über den Wandel auch in der Politik des Kulturbetriebes durch die Euphorie über das Oslo-Friedensabkommen von 1993. Diese lässt sogar den früheren Terroristen und späteren Friedensnobelpreisträger, den Palästinenserführer Jasser Arafat, zum Helden der israelischen Kulturszene werden. So begeistert sich das Akademiemitglied Nurit, ihres Zeichens Fotografin, für Arafat als künstlerisches Modell: „Ganz genau. Er und kein anderer. Stell dir mal vor: eine Ausstellung über seine Hände! […] Die Hände eines Kämpfers, mit Blut getränkt, Hände, die sich letztlich ausstrecken zum Friedensschluss. Was könnte ausdrucksstärker sein?“
Folgen Sie uns auf Facebook und X!
Melden Sie sich für den Newsletter an!
Dabei geht es nicht nur um entgegengesetzte politische, sondern auch um kunsttheoretische Ansichten, die bezüglich der Rezeption eines Kunstwerkes aufeinandertreffen. Itamar vertritt die Meinung, dass Melameds „Leben und sein Werk unumstößliche Fakten [sind]. Seine Kunst wird ganz unabhängig davon, wie auch immer sie interpretiert werden wird, Jahrhunderte überdauern.“ Dem widerspricht seine Geliebte, das Akademiemitglied Rita: „Es ist halt einfach so, dass der Wert von Melameds Werk relativ ist und sich mit der Zeit ändern kann – und zwar in Abhängigkeit vom Geschmacks- und Konzeptwandel“.
Dieser Konflikt wird insofern zum grundlegenden Problem für Itamars musikhistorisches und eigentlich unpolitisches Filmprojekt, als sein Held Melamed im Film in lebenswirklicher Größe gezeigt wird. Der Musiker „war ein außergewöhnlicher Mensch, restlos seiner Kunst hingegeben und kompromisslos mit sich selbst. Er hatte eine äußert originelle Weltsicht; er erlaubte es sich niemals, sich der ‚öffentlichen Meinung‘ zu beugen“.
Dies schließt Szenen im Originalton ein, in der Melamed über seine zionistische Haltung spricht. Diese sind jedoch für die friedensbewegte Nationalakademie nicht mehr akzeptabel, so dass sein Drehbuch letztendlich nicht reüssieren kann. Es wird kritisiert: „Melameds Auftritte haben Grenzen überschritten. […] So ein schneidender Ton in seinen Äußerungen. Eine gewisse Kraftmeierei, wenn er von Israel gesprochen hat“. Itamar dagegen, auf der Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit, stellt die Frage „was Melamed von diesem Versuch sagen würde… im Grunde vom Versuch, seine Überzeugungen zu unterschlagen.“
Melameds Witwe Sylvia dagegen freut sich darüber, dass der inzwischen von der Nationalakademie gedrehte, von Itamars Vorlage inhaltlich abweichende Film über ihren verstorbenen Ehemann im israelischen Kino Erfolg hat. Dabei versteht sie nicht die Details der israelischen Kulturpolitik und kann auch Itamars Leiden daran nicht nachvollziehen.
Kritik am israelischen Kulturbetrieb der 1990er Jahre
Der israelische Roman „Itamar K.“ ist autobiografisch beeinflusst. Im Gespräch erklärte Iddo Netanjahu, dass sein Roman die Art von Kulturkampf beschreibe, der inzwischen auch den Westen erreicht habe und dort mit dem Begriff „Cancel Culture“ charakterisiert werde. Damit werde die Tendenz beschrieben, Künstlern und Autoren aus politischen und ideologischen Gründen zum Beispiel den Raum für Auftritte und die Förderung von Projekten zu verweigern. Laut dem Autor herrschte in Israel Mitte der 1990er Jahre eine solche Situation im „progressiven“ und postzionistisch verwalteten Kulturbetrieb, so dass zionistisch und konservativ geprägten Künstlern der Zugang dazu verwehrt worden sei.
Der Autor berichtet auch von eigenen Erfahrungen aufgrund seiner politischen Überzeugungen, die wegen seiner Zugehörigkeit zu einer prominenten Familie in Israel allseits bekannt seien: Er sei mit seinen Theaterstücken und Prosawerken nicht nur vom israelischen Kulturbetrieb ausgeschlossen und negativ rezipiert, sondern auch in der israelischen Presse nachweislich diffamiert worden. Daher habe er bisher sein größtes Publikum in Amerika gehabt, wobei es auch in Europa zunehme.
Iddo Netanjahus Berufsweg begann als Soldat einer Kommandoeinheit in den israelischen Streitkräften. Seine zwei älteren Brüder Jonathan and Benjamin gehörten derselben Einheit an. Jonathan fiel 1976 bei der Operation zur Geiselbefreiung eines durch palästinensische und deutsche Terroristen entführten Air France-Passagierflugzeuges im ugandischen Entebbe. Der Autor studierte in Israel und den Vereinigten Staaten Medizin und arbeitete als Radiologe. Später folgte sein Entschluss, sich überwiegend dem Schreiben zu widmen. Weil ihm die Medizin als intellektuell zu anspruchslos erschien, begann er bereits als Student, Prosa zu verfassen.
Lesenswert für Israelinteressierte
Leser, die sich spezifisch für das Thema der „Cancel Culture“ interessieren, mögen sich mit dem Buch angesprochen fühlen. Für Israelinteressierte ist der Roman nicht auch zuletzt deswegen lesenswert, da er seit langem bestehende innere Konflikte der israelischen Gesellschaft über die Interpretation der eigenen Geschichte und die politische Zukunft des Landes auf eine überzeichnete, amüsante Art vermittelt.
Der Roman erschien 1998 auf Hebräisch und wurde bisher ins Russische und Italienische übersetzt. Seit 2023 liegt er in einer hervorragenden Übersetzung ins Deutsche von Artur Abramovych vor, die den humoristischen Charakter des Werkes glänzend wiedergibt. In seinem Nachwort diskutiert der Übersetzer den Roman als Ausdruck einer ideologischen Auseinandersetzung in Israel zwischen zionistischen und postzionistischen Überzeugungen und einer davon geprägten Kulturpolitik.
Von Nicolas Dreyer
Iddo Netanyahu: „Itamar K.: Roman“, Gerhard Hess, 299 Seiten, 22 Euro, ISBN: 978-3-87336-811-8.

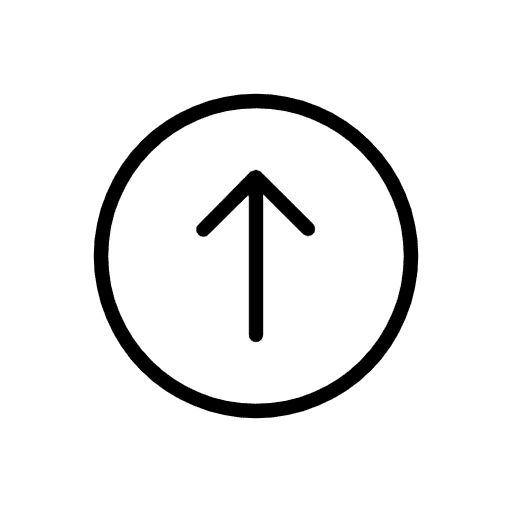
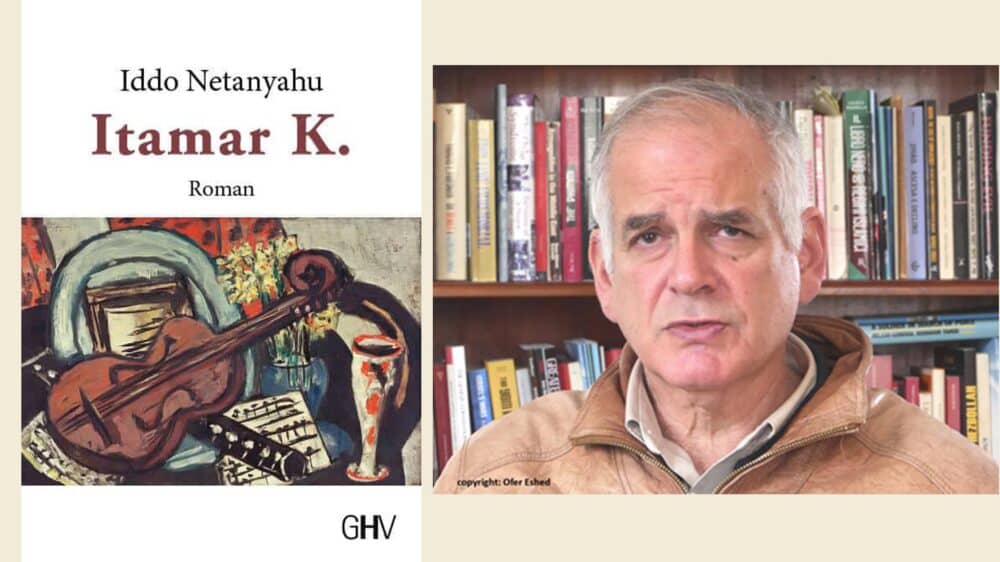




Eine Antwort
Iddo, Jonathan, Benjamin „Bibi“ Netanjahu. Eine wunderbare Familie.